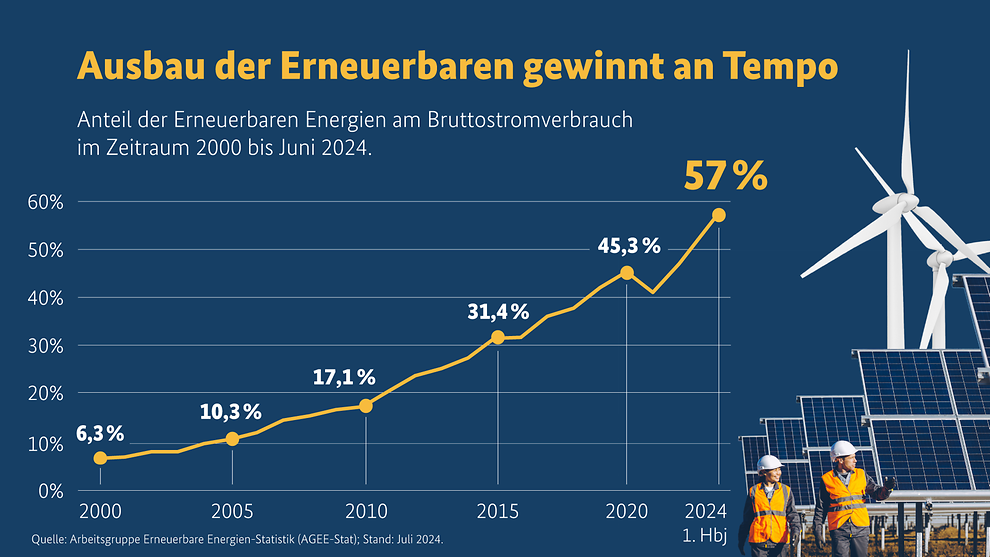
Die Energiewende in Deutschland steckt voller Herausforderungen. Erneuerbare Energien sollen fossile Energien im Stromnetz ablösen. Doch wie gelingt das effizient? RWE und E.ON fordern in einem Positionspapier einen Neustart der Energiewende – mit einem klaren Fokus auf den Markt. Doch bringt ihr Vorschlag wirklich mehr Effizienz und sinkende Strompreise? Oder verstärkt er die Abhängigkeit von großen Konzernen?
Dieser Beitrag nimmt das Positionspapier von RWE und E.ON genau unter die Lupe und stellt es in einen breiteren Kontext. Mit Erkenntnissen aus Studien von ifo-Institut, Fraunhofer CINES, dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) und VDE zeigen wir, welche Chancen und Risiken der Vorschlag birgt. Diese Institutionen haben den Vorschlag nicht direkt bewertet, aber ihre Analysen bieten wertvolle Perspektiven auf zentrale Themen der Energiewende – von der Netzregulierung über die CO₂-Bepreisung bis zur Flexibilisierung des Strommarkts. Ein anderer Aspekt bleibt hier ungeachtet: Die beiden Großkonzerne melden sich genau jetzt – zu dem Zeitpunkt, an dem der neue, erklärt wirtschaftsnahe, konzernfreundliche, bürokratie- und regulierungskritische Kanzler seine Regierung bildet 😉
RWE und E.ON: Die Großen planen die Energiewende neu
Die beiden Energiekonzerne wollen die Energiewende schlanker und wirtschaftlicher gestalten. Ihre Kernforderungen:
- Schnellere Genehmigungen für Infrastrukturprojekte
- Stabilere Rahmenbedingungen für Investitionen
- Wettbewerbsfähige Strompreise
- Förderung neuer Technologien und Netzausbau
Das klingt effizient – doch für wen genau bringt das Vorteile?
Welche Chancen bietet der Vorschlag?
1. Mehr Investitionssicherheit für Unternehmen
Wenn klare, langfristige Rahmenbedingungen gelten, können Unternehmen leichter in erneuerbare Energien und moderne Netze investieren. Das stärkt die Versorgungssicherheit und kann den Netzausbau beschleunigen.
2. Sinkende Strompreise für Verbraucher?
Eine schlankere Regulierung und besser abgestimmte Netzinfrastruktur könnten langfristig Strompreise stabilisieren oder sogar senken. Doch das setzt voraus, dass die Marktmechanismen tatsächlich fair für alle Akteure funktionieren.
3. Förderung neuer Technologien
RWE und E.ON setzen auf Innovation. Sie sehen in Energiespeichern, Smart Grids und Wasserstofflösungen große Chancen, um die Energiewende flexibler zu gestalten.
Wo liegen die Risiken?
1. Mehr Marktmacht für große Konzerne
Ein freier Markt sorgt nicht automatisch für faire Bedingungen. Kleine Anbieter, Stadtwerke oder Bürgerenergie-Projekte könnten gegenüber großen Playern wie RWE und E.ON ins Hintertreffen geraten.
Das ifo-Institut warnt vor einer möglichen Verzerrung: Große Unternehmen könnten den Markt dominieren, während dezentrale Energieerzeuger wie Mieterstrom-Anbieter oder Energy-Sharing-Modelle benachteiligt würden.
2. Fehlende Förderung für dezentrale Lösungen
RWE und E.ON setzen auf großflächige Netzinvestitionen. Doch die Energiewende passiert nicht nur in großen Kraftwerken. Lokale Lösungen wie Mieterstrom, Energy Sharing und Bürgerenergie ermöglichen es Menschen, aktiv an der Energiewende teilzunehmen.

Ein Beispiel: Die Lösung von PIONIERKRAFT ermöglicht es, lokal erzeugten Solarstrom direkt innerhalb eines Mehrfamilienhauses zu verteilen. Dabei wird überschüssiger Strom aus einer Photovoltaikanlage nicht einfach ins Netz eingespeist, sondern gezielt an die Mieter weitergeleitet. Die Nutzer profitieren von niedrigeren Energiekosten, während das Stromnetz entlastet wird.
Diese Form des lokalen Energy Sharings sorgt für eine faire Verteilung erneuerbarer Energie direkt vor Ort. Statt die Energieversorgung ausschließlich den großen Playern zu überlassen, können Haushalte selbst aktiv werden und sich unabhängig von steigenden Strompreisen machen.
Dezentrale Lösungen haben klare Vorteile:
- Kosteneinsparungen: Wenn der Strom direkt im Gebäude genutzt wird, entfallen Netzgebühren und Umlagen, was die Strompreise für Mieter senken kann.
- Unabhängigkeit: Mieter und Eigentümer können sich von steigenden Energiepreisen unabhängiger machen und ihre eigene Stromversorgung mitgestalten.
- Netzentlastung: Da lokal erzeugter Strom direkt vor Ort verbraucht wird, müssen weniger Kapazitäten im überregionalen Stromnetz vorgehalten werden.
- Mehr Bürgerbeteiligung: Energiegemeinschaften und Mieterstromprojekte ermöglichen es mehr Menschen, von der Energiewende finanziell zu profitieren, anstatt allein Großkonzernen die Kontrolle zu überlassen.
Während Großkonzerne wie RWE und E.ON die Energiewende aus einer zentralen Perspektive betrachten, fordert der BEE eine stärkere Unterstützung für Prosumermodelle. Energy Sharing, also das direkte Teilen von selbst erzeugtem Strom innerhalb von Hausgemeinschaften oder Quartieren, ist derzeit noch eine Randerscheinung. Dabei machen dezentrale Lösungen die Stromversorgung fairer, demokratischer und nachhaltiger.
3. Fehlende Anreize für Flexibilität
Die Energiewende braucht Flexibilität, um Schwankungen in der Stromerzeugung auszugleichen. Die VDE-Studie kritisiert, dass Marktmechanismen allein nicht ausreichen, um flexible Speichersysteme oder Lastmanagement wirtschaftlich zu machen. Ohne gezielte Anreize könnten dringend benötigte Flexibilitätslösungen auf der Strecke bleiben.
4. Soziale Ungerechtigkeit durch hohe Energiepreise
Laut Fraunhofer CINES belasten hohe Strompreise die Energiewende. Der BEE fordert daher eine Anpassung der Strompreisbestandteile, um Bürger und kleine Unternehmen zu entlasten. Falls der Markt die Preise allein regelt, könnten einkommensschwache Haushalte benachteiligt werden.
Fazit: Marktwirtschaft oder Steuerung?
Zusammenfassend folgt, worauf es in der Energiewende wirklich ankommt:
- Investitionen müssen langfristig stabil sein, damit Unternehmen und Bürger planen können.
- Dezentrale Lösungen wie Mieterstrom und Energy Sharing brauchen Förderung, um die Bürger aktiv einzubinden.
- Flexibilität im Strommarkt ist entscheidend, um erneuerbare Energien stabil ins Netz zu integrieren.
- Hohe Strompreise sind ein Hindernis, das politisch angegangen werden muss.
Die Energiewende braucht einen guten Mix aus Marktwirtschaft und Regulierung. Ohne gezielte Steuerung könnten große Konzerne profitieren, während dezentrale Akteure verlieren. Die Herausforderung bleibt, beides in Einklang zu bringen: eine effiziente, aber faire Energiewende.
Quellen:
VDE: Flexibilisierung des Energiesystems
VDE: Mehr Resilienz für die Strom und Kommunikationsnetze in Deutschland
IFO: Strommarkt – Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit
