Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil gefällt, das auf einem Vorabentscheidungsersuchen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) basiert und die rechtliche Figur der „Kundenanlage“ nach § 3 Nr. 24a EnWG neu einordnet. Ziel der Entscheidung war es, die deutsche Sonderregelung mit europäischem Energierecht abzugleichen.
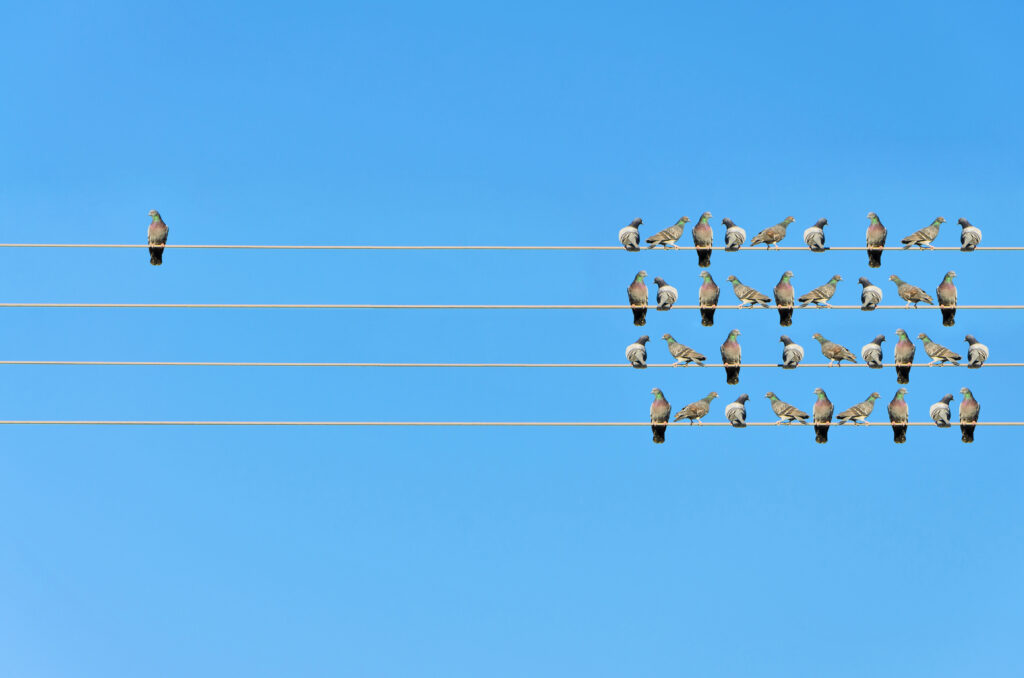
Das Ergebnis: Kundenanlagen, über die Strom an Letztverbraucher verkauft wird, können unter bestimmten Umständen als Verteilernetze gelten – mit allen Pflichten, die das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für Netzbetreiber vorsieht.Für viele klassische Mieterstrom- oder Quartiersstromprojekte bedeutet das zusätzliche Anforderungen, höhere Komplexität und mehr Regulierung. Verständlich, dass Eigentümer und Verwalter von Mehrfamilienhäusern sich fragen: Gilt das auch für meine Projekte? Und: Wie sicher ist die Umsetzung mit Pionierkraft?
Was genau ist eine „Kundenanlage“?
Nach § 3 Nr. 24a EnWG ist eine Kundenanlage ein Stromnetz, das sich innerhalb eines räumlich zusammenhängenden Gebiets befindet, von einem Dritten betrieben wird und nicht Teil eines öffentlichen Versorgungsnetzes ist. Solche Kundenanlagen unterliegen in der Regel nicht den gleichen regulatorischen Pflichten wie ein öffentliches Verteilnetz.
Der EuGH hat nun klargestellt, dass es für die europarechtliche Beurteilung nicht nur auf die technische Ausführung ankommt, sondern auch auf die Funktion der Anlage. Wird über eine Kundenanlage Strom an Dritte gegen Entgelt weitergegeben, kann das als Betrieb eines Elektrizitätsverteilernetzes gewertet werden.
Netzbetreiberpflichten – und ihre Folgen in der Praxis
Falls ein Modell als Verteilernetz gilt, greifen umfangreiche Netzbetreiberpflichten. Für Eigentümer und Verwalter hätte das erhebliche Folgen:

- Anschluss- und Zugangsverpflichtung (§ 17, 20 EnWG)
- Folge: Jeder Dritte, der innerhalb des Versorgungsgebiets Strom beziehen oder einspeisen möchte, muss technisch und vertraglich Zugang erhalten.
- Praxis: Eigentümer könnten nicht mehr allein entscheiden, wer angeschlossen wird; auch fremde Anlagenbetreiber hätten Anspruch.
- Entgeltregulierung und Netzentgeltkalkulation (§§ 21 ff. EnWG)
- Folge: Netzentgelte müssten nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur kalkuliert, veröffentlicht und abgerechnet werden.
- Praxis: Hoher Verwaltungsaufwand, Genehmigungsverfahren und laufende Berichtspflichten.
- Messstellenbetrieb (§ 3 MsbG)
- Folge: Verpflichtung, für alle angeschlossenen Letztverbraucher Messstellen zu betreiben oder zu organisieren.
- Praxis: Zusätzliche Kosten und Schnittstellen zum Messstellenbetreiber, ggf. Zwang zu Smart-Meter-Rollout.
- Datenaustausch und Marktkommunikation (MaKo 2022)
- Folge: Teilnahme am standardisierten elektronischen Datenaustausch (z. B. Lieferantenwechsel, Bilanzkreismanagement).
- Praxis: IT-Anbindung an energiewirtschaftliche Systeme, Know-how-Aufbau oder Dienstleisterkosten.
- Regulatorische Meldungen und Berichte (§ 12 EnWG, BNetzA-Anforderungen)
- Folge: Jährliche Meldungen zu Netzkennzahlen, Versorgungsunterbrechungen, Investitionen etc.
- Praxis: Administrativer Overhead, der für Wohnungsunternehmen ohne Energiewirtschaftsbereich kaum leistbar ist.
- Technische Regeln und Netzsicherheit (§ 49 EnWG)
- Folge: Einhaltung der technischen Sicherheitsanforderungen, regelmäßige Prüfungen und Störungsmanagement.
- Praxis: Zusätzliche Wartungs- und Dokumentationspflichten, Risiko bei Nicht-Einhaltung.
Das Risiko für klassische Mieterstrom-Modelle
Für Mieterstrommodelle mit gemeinsamer interner Stromverteilung bedeutet diese Einstufung als Netzbetreiber potenziell:
- Mehrkosten für Genehmigungen, Mess- und Abrechnungssysteme
- Verlust der alleinigen Gestaltungshoheit über den Anschluss
- Verpflichtung zu Transparenz und Gleichbehandlung auch für Wettbewerber
Gerade für Eigentümer, die diese Modelle primär zur Wirtschaftlichkeitssteigerung einsetzen, kann der Zusatzaufwand die Kalkulation erheblich verschlechtern.
Warum das Pionierkraft-Modell nicht betroffen ist
Das im Juli 2025 erstellte Rechtsgutachten zu Pionierkraft stellt klar: Die Lösung fällt nicht unter die Definition der Kundenanlage.

Begründung:
- Direktleitungen (§ 3 Nr. 12 EnWG) statt interner Netze
- Netzparallele, individuelle Verbindung zwischen Erzeugung und Verbrauch
- Keine „Netzqualität“ und keine Integration ins öffentliche Netz
Die BNetzA (Beschluss BK6-20-258) und die Bayerische Regulierungsbehörde bestätigen diese Regulierungsfreiheit.
Vertrags- und Steueraspekte beim Pionierkraft-Modell
- Keine Koppelungsverbote wie bei § 42a EnWG (Mieterstrom) oder § 42b EnWG (GGV)
- Stromlieferung als unselbstständiger Teil des Mietvertrags
- Umsatzsteuerpflicht für die Stromlieferung (Kleinunternehmerregelung möglich)
- Stromsteuerbefreiung bei lokalem Verbrauch innerhalb 4,5 km
Kein Einfluss des Netzbetreibers
Ein zentraler Vorteil der Pionierkraftlösung ist, dass sie „behind the meter“ arbeitet. Die Direktleitungen beginnen hinter dem Hausanschluss und Zähler des Gebäudes und verlaufen direkt zu den einzelnen Verbrauchseinheiten. Dadurch hat der Netzbetreiber weder technischen noch rechtlichen Zugriff auf den Betrieb.
1. Keine Anwendung von § 14a EnWG (netzorientierte Steuerung)
§ 14a EnWG erlaubt Netzbetreibern, steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen oder Wallboxen in Zeiten hoher Netzauslastung herunterzuregeln.
- Praxisbeispiel: In einem Mietshaus mit klassischem Netzanschluss kann der Netzbetreiber bei hoher Netzlast die Ladeleistung einer E-Auto-Ladestation auf 1,4 kW drosseln. Bei einer Pionierkraft-Direktleitung entscheidet der Betreiber selbst, wie die Energie verteilt wird – der Netzbetreiber hat kein Eingriffsrecht.
2. Keine Vorgaben zu Netzausbau oder Anschlusspriorität
Netzbetreiber dürfen bei regulierten Netzen Bedingungen für den Anschluss neuer Anlagen stellen – etwa Verstärkungen oder Netzoptimierungen verlangen.
- Praxisbeispiel: In einer Kundenanlage könnte der Netzbetreiber bei einer zusätzlichen PV-Anlage auf dem Dach fordern, dass der interne Netzstrang verstärkt wird. Bei Pionierkraft-Direktleitungen besteht diese Pflicht nicht, da es sich nicht um ein Netz der allgemeinen Versorgung handelt.
3. Unabhängige Betriebsführung und Abrechnung
Da Pionierkraftleitungen nicht in das öffentliche Netz eingebunden sind, gibt es keine Vorgaben zu Messkonzepten oder Marktkommunikation durch den Netzbetreiber.
- Praxisbeispiel: In einem regulierten Netz muss der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber oder einen beauftragten Messstellenbetreiber erfolgen – oft mit höheren Fixkosten. Mit Pionierkraft bestimmt der Betreiber selbst, welche Messtechnik er einsetzt und wie die Abrechnung erfolgt, solange sie den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht.
4. Keine Einschränkung bei der Preisgestaltung
Netzbetreiber sind an Entgeltregulierungen gebunden. Bei Pionierkraft gibt es keine Netzentgeltvorgaben, solange keine verdeckten Netzentgelte erhoben werden.
- Praxisbeispiel: Ein Eigentümer kann für den lokal gelieferten Solarstrom einen festen Preis pro kWh vereinbaren, ohne diesen vorher bei der Bundesnetzagentur zu melden oder genehmigen zu lassen – wichtig für wirtschaftliche Kalkulationen.
Fazit: Hohe Sicherheit für Eigentümer und Verwalter
Mit Pionierkraft umgehen Eigentümer die beschriebenen Netzbetreiberpflichten und deren Kosten. Das Modell ist rechtlich bestätigt, regulatorisch unabhängig und zukunftsfähig, auch wenn sich der Rechtsrahmen für Kundenanlagen verschärft.